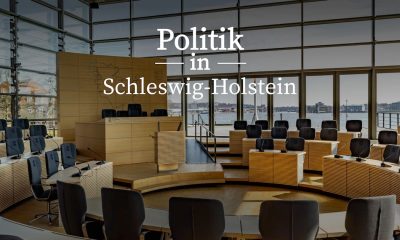Sports
Klimakrise – Pakistan: Wenn der Himmel Angst macht

Der Monsunregen ist heftiger geworden: Überschwemmungen wie hier in Jalalpur Pirwala in der Provinz Punjab haben in Pakistan seit einigen Jahren zugenommen.
Foto: AFP/Shahid Saeed MIRZA
Samina Shabir blickt in den Himmel. Es regnet – schon wieder. Die zierliche Frau lebt mit ihrem Mann und ihren sechs Kindern im Dorf Jolo Dahrio in der pakistanischen Provinz Sindh. Ihr ganzes Leben hat sie hier verbracht. Seit Kurzem engagiert sie sich im örtlichen Komitee für Klimagerechtigkeit, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
»Wenn der Himmel wolkenverhangen ist, bekomme ich Angst«, sagt sie. Seit den Fluten von 2022, bei denen sie alles verlor, lässt sie die Furcht nicht mehr los – die Angst vor dem Regen und den zerstörerischen Wassermassen, die er bringen kann. Vor drei Jahren hatte Extremregen die gesamte Provinz Sindh monatelang unter Wasser gesetzt. 33 Millionen Menschen wurden damals vertrieben – es war eine der schwerwiegendsten Klimakatastrophen weltweit.
Seit Mitte August dieses Jahres haben anhaltende Regenfälle erneut Flüsse und Stauseen über die Ufer treten lassen – große Teile Pakistans stehen wieder unter Wasser. Überschwemmungen gehören zur Monsunzeit, doch ihre Häufigkeit und Intensität nehmen spürbar zu. Eine aktuelle Studie der World Weather Attribution zeigt: Die vom Menschen verursachte Erderhitzung verstärkt solche Extremereignisse bereits heute – um zehn bis 15 Prozent. Die Folgen sind schon jetzt verheerend.
Nach schweren Sturzfluten in den nördlichen Provinzen Khyber Pakhtunkhwa und Gilgit-Baltistan weiten sich die Überschwemmungen nun weiter nach Süden aus. In der Provinz Punjab haben die Wassermassen zuletzt ganze Häuser mitgerissen. Über 1000 Menschen wurden verletzt, rund 300 000 mussten ihre Häuser verlassen. Viele wurden in provisorischen Lagern untergebracht, andere fanden Zuflucht bei Verwandten. Immerhin, ein Ende ist in Sicht – der Monsun wird vermutlich in den kommenden Wochen nachlassen.
Auch Indien ist von den Überschwemmungen betroffen und versucht, das Schlimmste durch die Öffnung von Staudämmen an drei Nebenflüssen des Indus zu verhindern. Doch die Wassermassen fließen weiter nach Pakistan – und verschärfen dort die ohnehin angespannte Situation. Noch hat das Wasser Saminas Dorf Jolo Dahrio nicht erreicht. Doch in der gesamten Provinz Sindh wird noch immer mit überfluteten Straßen, Stromausfällen und unterbrochener Telekommunikation gerechnet.
Unsere Fahrt von Karatschi zu Samina dauert fast fünf Stunden, die letzten Kilometer führen nur noch über staubige Feldwege. Umringt von anderen Frauen kommt sie uns mit festem Schritt entgegen. Früher besaß sie fünf Büffel, drei Kühe und fünf Ziegen, sie ermöglichten ihr und ihrer Familie ein einigermaßen gesichertes Auskommen. Doch seit der Flutkatastrophe 2022 ist davon nichts mehr übrig. Saminas Dorf, wie viele andere in der Umgebung, wurde um mehr als ein Jahrzehnt in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Jede weitere Krise – selbst eine vergleichsweise kleine wie die drohende Überschwemmung – bringt die Menschen hier erneut an den Rand der Existenz.
Die Armut grassiert
»Ich habe nicht mehr viel. Und mit dem Wenigen, das mir bleibt, muss ich entscheiden, ob ich es in unser Überleben stecke – oder in die Bildung meiner Kinder«, sagt Samina. Ihre Worte spiegeln eine Realität, die sie mit vielen in Jolo Dahrio teilt – und die sie oft an den Rand der Verzweiflung bringt. Die vier Kilometer entfernte Schule wurde 2022 ebenfalls zerstört. Inzwischen findet dort wieder Unterricht statt, im Gegensatz zu vielen anderen Schulen in der Region, die noch immer in Trümmern liegen.
»Weil ich darauf bestehe, dass meine Töchter zur Schule gehen können, muss ich die Zahl meiner täglichen Mahlzeiten reduzieren«, erzählt Samina nüchtern. Dann senkt sie die Stimme: »Ich musste dafür meinen Schmuck verkaufen.« Ein Satz, der mehr bedeutet als der Verlust eines materiellen Werts – der Schmuck war ihr einziger Besitz, ihr Symbol von Würde und Selbstbestimmung.

Samina Shabir verlangt mehr Hilfen für die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Menschen.
Foto: Medici International
Die Provinz Sindh, in der Samina lebt, gehört weltweit zu den am stärksten von Klimakatastrophen betroffenen Regionen. Immer wieder wurde sie in den vergangenen zehn Jahren von Fluten, Dürren und Hitzewellen heimgesucht. Wie soll man hier überleben?
In Rasheed Wagan, einem Dorf im Norden der Provinz Sindh, treffen wir Ghulam Fizan. Immer wieder stehen Schuldeneintreiber vor ihrer Tür, fordern Zinsen für das Geld, das Ghulam sich leihen musste, um ihre Familie zu ernähren. Doch sie kann die Schulden nicht zurückzahlen.
So ergeht es Millionen Landarbeiter*innen und Kleinbäuer*innen in Sindh: Sie rutschen immer tiefer in die Verschuldung, während die Zinslast stetig wächst. »Früher hatten wir ein Haus mit zwei Zimmern – eines für mich, meinen Mann und unsere sieben Kinder, und ein zweites für Gäste«, erzählt Ghulam. »Jetzt leben wir alle zusammen in dem einzigen Raum, den wir nach der Flut 2022 notdürftig wieder instand setzen konnten.«
Wut und Enttäuschung klingen in Saminas Stimme mit, die Situation hat sich seit der Flut von 2022 kaum verändert. Hilfe hat die Frau weder von staatlicher Seite noch aus anderen Quellen erhalten. Auch Ghulam fürchtet die erneuten Überschwemmungen, die derzeit auf Sindh zukommen. Der Gedanke, erneut ihr gesamtes Hab und Gut, das Vieh und das Saatgut zu verlieren, scheint unerträglich. Aus purer Verzweiflung folgt sie den Evakuierungsaufforderungen des staatlichen Katastrophenschutzes bislang nicht. Mit bitterem Ton sagt sie: »Ich werde erst gehen, wenn das steigende Wasser mich dazu zwingt.«
Seit der Flut hat sich die ohnehin tiefe soziale Kluft zwischen Familien wie denen von Samina und Ghulam und den Großgrundbesitzern in Sindh weiter verschärft. Vertrocknete Böden, zerstörte Bewässerungssysteme, versalzene oder kontaminierte Felder und verschmutztes Grundwasser führen zu Krankheiten und sinkenden Erträgen.

Ghulam Fizan lebt mit ihrer Familie im Norden der Provinz Sindh
Foto: Medico International
In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl extremer Wetterereignisse in Pakistan mehr als verdreifacht – sie sind längst Teil eines neuen Normalzustands geworden. Die Regierung reagiert mit dem Ausbau des Katastrophenschutzes: Frühwarnsysteme und Kommunikationswege für Evakuierungen werden verbessert, die Versorgung der Betroffenen soll künftig besser koordiniert werden.
»Weil ich darauf bestehe, dass meine Töchter zur Schule gehen können, muss ich die Zahl meiner täglichen Mahlzeiten reduzieren.«
Samina Shabir
In den vergangenen Wochen konnten bereits mehrere Tausend Menschen aus den Hochwassergebieten in Sicherheit gebracht werden. Es wurden medizinische Stationen eingerichtet und Hilfsgüter wie Zelte, Lebensmittelpakete und Schwimmwesten verteilt. Doch dem tatsächlichen Bedarf ist Pakistan nicht gewachsen – und wird es auch in Zukunft kaum sein.
Laut dem Weltklimarat wird die Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen infolge der fortschreitenden Erderhitzung weiter zunehmen, während die gesellschaftlichen Kapazitäten für Vorsorge, Schutz, Wiederaufbau und Krisenbewältigung mit jeder neuen Katastrophe weiter erodieren.
Zwar wurde auf den vergangenen Weltklimakonferenzen immer wieder die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Anpassung und Bewältigung klimabedingter Schäden beschlossen – doch Pakistan hat bislang kaum etwas von den versprochenen, dringend benötigten Hilfen erhalten. Menschen wie Samina, Ghulam oder ihre Nachbar*innen schon gar nicht.
Pakistan wird erneut zum Brennglas der Folgen eines längst überschrittenen 1,5-Grad-Ziels. Dabei hat das Land weniger als 0,5 Prozent der historischen Treibhausgasemissionen verursacht. Ein drastisches Beispiel für die globale Ungleichheit zwischen Verursachung und Leidtragenden der Klimakrise.
In Deutschland kennt kaum jemand Samina, Ghulam oder ihre Dörfer. Wahrscheinlich wissen nur wenige überhaupt, wo die Provinz Sindh liegt, obwohl dort rund 55 Millionen Menschen leben. Pakistan und das Leben seiner Bevölkerung scheinen weit entfernt. Vielen ist hingegen die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 noch präsent: 42 000 Menschen waren damals betroffen. Noch immer – vier Jahre später – ist die Region gezeichnet, viele der Betroffenen sind traumatisiert, der Wiederaufbau ist unvollständig. Und das in einem der reichsten Länder der Welt.
Organisiert gegen die Klimakrise
In Pakistan waren 2022 nicht Zehntausende, sondern fast ein Sechstel der Bevölkerung betroffen. Wie viele Millionen in diesem Jahr unter den Überschwemmungen leiden werden, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Doch angesichts dieser Dimensionen braucht es wenig Vorstellungskraft, um die Überforderung und Verzweiflung von Menschen wie Samina und Ghulam zu begreifen.
Die Hilfsorganisation Hands Welfare Foundation und der Gewerkschaftsverband National Trade Union Federation (NTUF) versorgen die Menschen seit Beginn des Monsunregens mit dem Nötigsten: Nahrung, Trinkwasser und Medikamenten. Zugleich unterstützen sie Samina und Ghulam in ihrem Einsatz für Gerechtigkeit.
Seit Jahren arbeiten die beiden in Karatschi ansässigen Organisationen eng mit den Gemeinden zusammen. Sie entwickeln Maßnahmen für den Katastrophenschutz, erarbeiten Strategien für klimaresilienten Hausbau, Wasserversorgung und Landwirtschaft, und organisieren landlose Bäuer*innen, um ihre Rechte gegenüber Großgrundbesitzern und Schuldknechtschaft zu verteidigen.
»Durch Hands und NTUF haben wir erfahren, dass die Überschwemmungen keine Strafe Gottes sind – sondern menschengemacht«, berichtet Samina. Während sie spricht, beginnen ihre Augen zu leuchten. »Seitdem organisieren wir uns«, fügt sie entschlossen hinzu. Samina und Ghulam haben in ihren Dörfern Komitees ins Leben gerufen, um die Verantwortlichen für die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen zur Rechenschaft zu ziehen. Klimagerechtigkeit bedeutet für sie, die nötigen Mittel zu erhalten, um wieder selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden zu können. »Wir werden Tag für Tag für unsere Rechte kämpfen«, sagt Samina mit fester Stimme. »Meine ganze Familie steht hinter mir.«
Karin Zennig ist Klima- und Südasienreferentin bei der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International.
Thomas Seibert war jahrelang Menschenrechtsreferent bei Medico und reist seit 2010 regelmäßig nach Pakistan.
Sports
EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele
Rückschlag für den Klimaschutz
Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.
Weiterlesen nach der Anzeige
Weiterlesen nach der Anzeige
Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.
Tricksereien bei Klimaprojekten
Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.
Weiterlesen nach der Anzeige
Weiterlesen nach der Anzeige
Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.
Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab
Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.
Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.
Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.
Sports
Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?
Sports
NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen
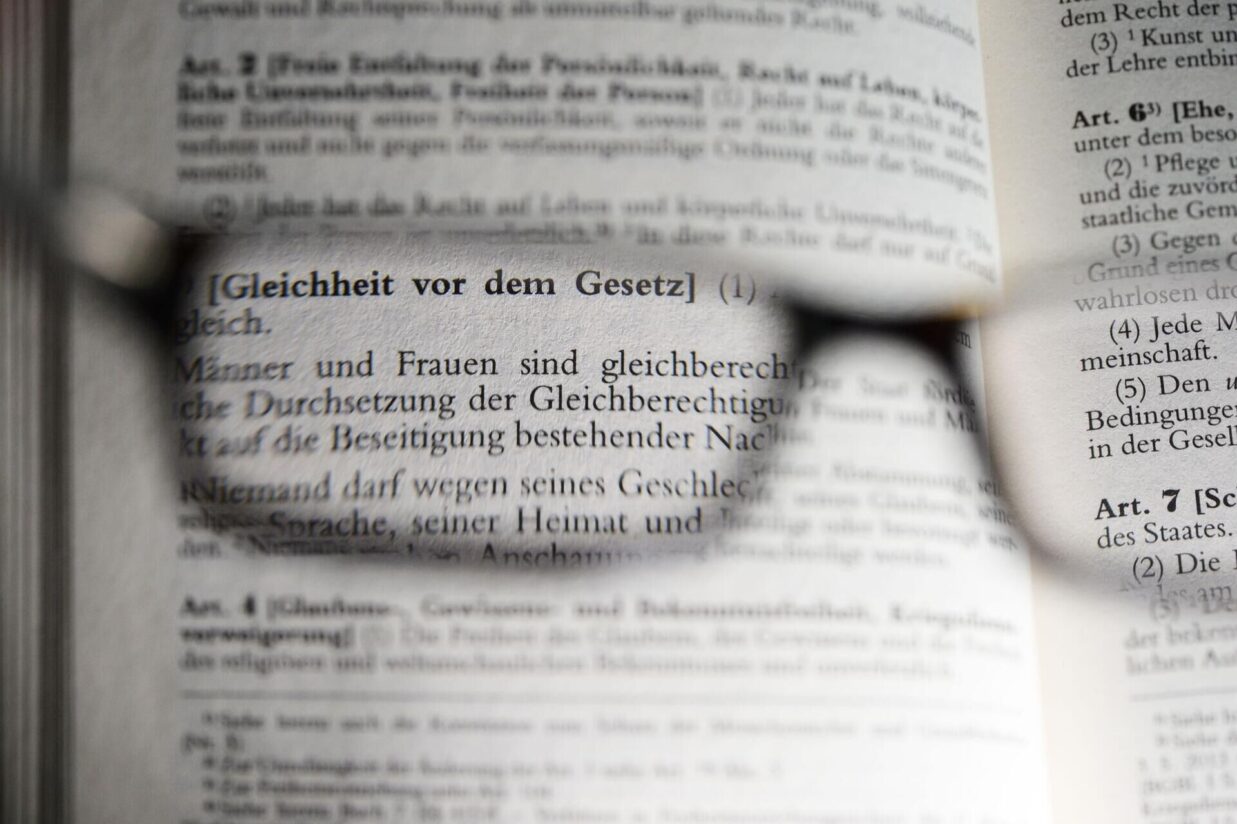
Lesezeit
Verfasst von:
dpa
Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.
Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.
NRW will vorangehen
Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.
Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.
Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.
Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden
Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.
Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.
Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.
-

 Business9 months ago
Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access
-

 Tech9 months ago
Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress
-

 Fashion7 months ago
Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog
-

 Fashion7 months ago
Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog
-

 Fashion7 months ago
Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog
-

 Entertainment6 months ago
Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality
-
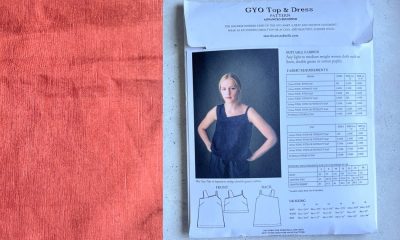
 Fashion4 months ago
Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025
-

 Fashion9 months ago
Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!