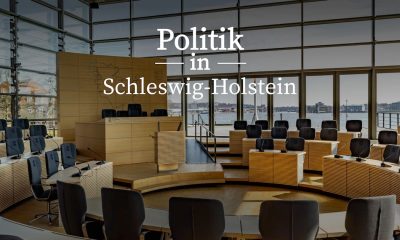Sports
Kritische Theorie – Arbeit: Das halbe Leben
Sinnbild des Nichttätigseins: Das Liegen auf dem Wasser führte Theodor W. Adorno gegen den Arbeitszwang an.
Foto: iStock/Barbara Gabay
Auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen» – so umschrieb Theodor W. Adorno das Nichtstun als Motiv einer unerfüllten Utopie in den «Minima Moralia». Das Utopische liege außerhalb, nicht innerhalb der Arbeit. Es ließen sich unzählige weitere Zitate von Adorno auftreiben, in denen diese arbeitskritische Haltung hervorscheint. Umso verwunderlicher ist es, dass nach wie vor umstritten ist, welche Rolle der Arbeitsbegriff in dessen Werk überhaupt spielt. Und das gilt für die Kritische Theorie insgesamt.
Dem Arbeitsbegriff in der Kritischen Theorie widmet sich deshalb nun der von Philipp Lorig, Virginia Kimey Pflücke und Martin Seeliger im Mandelbaum-Verlag herausgegebene Sammelband «Arbeit in der Kritischen Theorie. Zur Rekonstruktion eines Begriffs» – wobei der Titel irreführend ist, da hier weitaus mehr als eine bloße Begriffsrekonstruktion vorgelegt wird. Neben dem Begriff der Arbeit in der Kritischen Theorie erfährt man auch einiges zur Arbeitsweise der Kritischen Theorie selbst. Dabei wird nicht nur auf Autoren wie Adorno oder Max Horkheimer eingegangen, sondern auch auf «Randfiguren» der ersten Generation wie Siegfried Kracauer oder Franz Neumann, sowie auf oftmals vergessene Autor*innen späterer Generationen, wie etwa Regina Becker-Schmidt, Alfred Schmidt oder Gerhard Brandt.
Gesellschaftskritisches Fundament
Mit dem Sammelband verweisen die Herausgeber*innen auf eine Forschungslücke. In der Kritischen Theorie lässt sich eine auffallende Abwesenheit des Arbeitsbegriff beobachten: auffallend, weil der Arbeitsbegriff – vor allem in negativer Hinsicht – eine konstitutive Rolle für die Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule zu spielen scheint; abwesend, weil er nur implizit enthalten ist. In der Einleitung konkretisieren die Herausgeber*innen diese Feststellung. So habe es in der frühen Kritischen Theorie keine dezidierte Auseinandersetzung mit Arbeit und Arbeitssoziologie gegeben. Jedoch wird von den Herausgeber*innen auf drei Grundmotive verwiesen, in denen der Arbeitsbegriff immer wieder zum Tragen kommt: Naturbeherrschung, Entfremdung und Verdinglichung. Diese Kernbegriffe hätten aber – so die vorangestellte Diagnose des Buches – bei späteren Vertretern der Kritischen Theorie an Bedeutung verloren. Damit seien auch die Potenziale eines kritischen Arbeitsbegriffes verloren gegangen. Eine Rekonstruktion – so hoffen es die Herausgeber*innen – könne das «gesellschaftskritische Fundament» der Theorietradition wiederbeleben und schlussendlich einer «aktualisierten Kritischen Theorie der Arbeit» den Weg ebnen.
Bereits die ersten beiden Beiträge des Sammelbandes dämpfen diese hohe Erwartung ab, indem sie deutlich machen, dass es mit einer bloßen Begriffsrekonstruktion nicht getan ist. Hans-Ernst Schiller argumentiert beispielsweise, dass «Adornos Utopie» zwar die Vorstellung einer radikalen Arbeitszeitverkürzung enthält, sein Arbeitsbegriff nichtsdestotrotz analytisch unscharf bleibt. Ungleich härter fällt die Kritik von Diethard Behrens aus, der den «unpräzisen Arbeitsbegriff» von Adorno und Horkheimer auf eine «selektive Rezeption» der Marx’schen Ökonomiekritik zurückführt.
Kapitalistische Spezifik?
Damit entpuppt sich die Frage nach dem Arbeitsbegriff als Frage nach dem Verhältnis von Kritischer Theorie und Marx’ Kritik der Politischen Ökonomie. Mit dem im «Kapital» dargestellten «Doppelcharakter» erhob Marx den Anspruch, die spezifische Form der Arbeit im Kapitalismus entdeckt zu haben. Gerade diese Entdeckung ist, folgt man Behrens, von Adorno und Horkheimer aber nur ungenügend beachtet worden. Bei Horkheimer sei diese Leerstelle auf die Marx-Interpretation von Friedrich Pollock, dem damaligen Chefökonomen im Institut für Sozialforschung (IfS), zurückzuführen. Dessen «historische Lesart» – nach der die Anfangskategorien im «Kapital» als verschiedene geschichtliche Entwicklungsstufen verstanden werden – habe Horkheimer maßgeblich beeinflusst. Unverstanden blieb dadurch die für die kapitalistische Gesellschaft historisch-spezifische Bedeutung der Marx’schen Kategorien. Entsprechend stellt Behrens nüchtern fest: «Von einem Begreifen der Wertformanalyse ist man ziemlich weit entfernt.»
Die Frage nach dem Arbeitsbegriff entpuppt sich als Frage nach dem Verhältnis zu Marx’ Kritik der Politischen Ökonomie.
In Bezug auf die «Dialektik der Aufklärung» kommt Marcel Stoetzler in seinem Beitrag zu einem ähnlichen Ergebnis. Arbeit werde hier oftmals in einem anthropologischen Sinne als bloße Naturbearbeitung verstanden. Entsprechend zeige sich das in Adornos und Horkheimers Konzeption der Dialektik: Die Menschheit habe sich durch die Beherrschung der Natur mittels Arbeit von den unmittelbaren Naturzwängen befreit, sich aber wiederum der Arbeit unterworfen und sei dadurch in den Bannkreis der instrumentellen Vernunft geraten. Befreiung und Beherrschung durch Arbeit erscheint hier als zivilisationsübergreifender Prozess.
Verdinglichung der Arbeit
Gleichzeitig lassen sich aber auch konträre Aussagen finden, in denen Adorno und Horkheimer – die Intention von Marx’ Kritik der Politischen Ökonomie aufgreifend – Herrschaft durch Arbeit als Spezifik der kapitalistischen Moderne identifizieren. Diese Spannung zwischen historisch-spezifischer und transhistorischer Deutung zeige sich, so Behrens, vor allem im Begriff des «Tauschprinzips», mit dem Adorno zwar auf Marx rekurriere, gleichzeitig aber Gefahr laufe, dessen Kritik auf die Zirkulationssphäre zu beschränken und die Arbeit als überzeitliche Konstante zu hypostasieren.
Dass sich die Tendenz, Arbeit jenseits ihrer konkreten gesellschaftlichen Gestalt zu fassen, auch bei anderen Autor*innen des westlichen Marxismus finden lässt, zeigt Claus Baumann in seinem Beitrag anhand von Georg Lukács und Hans Heinz Holz. Ob Arbeit nun, wie bei Holz, als Stoffwechselprozess verstanden werde oder, wie bei Lukács, als «Telosrealisation», also Selbstverwirklichung – in beiden Fällen bleibe die begriffliche Bestimmung ihrer gesellschaftlichen Dimension unzureichend.
Deutlich wird, dass es sich bei den theoretischen Widersprüchen des Arbeitsbegriffes nicht um ein genuines Problem der Kritischen Theorie, sondern des Marxismus insgesamt handelt. Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, ob ein – für das Projekt einer «aktualisierten Kritischen Theorie der Arbeit» – wegweisender Arbeitsbegriff überhaupt ohne Weiteres rekonstruiert werden kann. Die in diesem Zusammenhang diskutierten Beiträge legen vielmehr nahe, dass es einer grundlegenden Kritik des Begriffs bedürfe.
nd.DieWoche – unser wöchentlicher Newsletter

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Im Sammelband finden sich jedoch auch optimistischere Stimmen, die eine andere Perspektive eröffnen. Insgesamt treten dadurch stark divergierende Einschätzungen zutage: Während Ulf Bohmann und Tanja Hoss das emanzipatorische Potenzial von Herbert Marcuses Arbeitsbegriffs hervorheben, kritisieren Jonas Balzer und Ansgar Martins dessen Tendenz zur unhistorischen «Arbeitsontologie». Die Unterschiedlichkeit der Positionen lässt sich einerseits als Ausdruck inhaltlicher Breite deuten. Gleichzeitig entsteht dadurch aber auch der Eindruck einer fragmentierten Diskussion.
Anschluss zur Arbeitssoziologie
Dafür bietet der Sammelband aber Einblicke in einige Diskussionsstränge, die in dem Dickicht der Sekundärliteratur zur Kritischen Theorie üblicherweise vernachlässigt werden. Beispielsweise präsentiert der Beitrag von Felix Gnisa die industriesoziologische Forschung am IfS in den 70er und 80er Jahren: Unter der Leitung des damaligen Institutsleiters Gerhard Brandt wurden zahlreiche empirische Forschungen angestoßen, bei denen man sich an dem Marx’schen Konzept der «reellen Subsumtion» und der Theorie von Alfred Sohn-Rethel orientierte. Nach der sozialphilosophischen Wende des Instituts unter Axel Honneth sind diese Forschungsprojekte weitgehend in Vergessenheit geraten, dabei enthalten sie wertvolle Einsichten in das Verhältnis von Kritischer Theorie und empirischer Forschung sowie Anknüpfungspunkte für gegenwärtige arbeitssoziologische Fragen. Es gehört zu den Stärken des Sammelbandes auch diesen Kapiteln der Kritischen Theorie Geltung verschafft zu haben.
Philipp Lorig, Virginia Kimey Pflücke und Martin Seeliger (Hg.): Arbeit in der Kritischen Theorie. Zur Rekonstruktion eines Begriffs. Mandelbaum 2024, 588 S., br., 37 €.
Sports
EU-Umweltminister schwächen Klimaziele 2040: CO₂-Reduktion gefährdet

EU verzögert CO₂-Ziele
Rückschlag für den Klimaschutz
Die EU-Umweltminister haben sich auf ein heftiges Wendemanöver beim Klimaschutz geeinigt. Das Ziel, bis 2040 die CO2-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, bleibt zwar formal bestehen. Doch nun soll eine Hintertür, eigentlich ein Scheunentor, eingebaut werden.
Weiterlesen nach der Anzeige
Weiterlesen nach der Anzeige
Die EU-Staaten können bis zu 5 Prozent der Reduktionen mittels eines Ablasshandels erledigen – indem sie Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren. Zudem wird der Start des Emissionshandels für den Verkehr und fürs Heizen (ETS2) um ein Jahr auf 2028 verschoben.
Tricksereien bei Klimaprojekten
Was hier gerade passiert, ist eine Art Ausschwemmen von Klimaprojekten. Eins nach dem anderen wird vertagt, verwässert, entschärft. So ist der Ablasshandel wie gemacht für allerlei Tricksereien, die Klimaschutz nur vorgaukeln.
Weiterlesen nach der Anzeige
Weiterlesen nach der Anzeige
Mit der Verschiebung von ETS2 wird das ambitionierteste Vorhaben der EU auf die lange Bank geschoben. Ein starker Anreiz sollte entstehen, um auf Elektroautos und Wärmepumpen umzusteigen. Dass es nun erst 2028 damit losgehen soll, ist ein eindeutiges Signal. Es darf bezweifelt werden, dass es bei diesem Termin bleibt.
Ungarn und Polen lehnen den CO₂-Handel ab
Denn Ungarn und Polen wollen eigentlich nicht vor dem Jahr 2030 irgendetwas mit ETS2 zu tun haben. Der slowakische Landwirtschaftsminister Richard Takáč hat gerade sogar das endgültige Aus von ETS2 gefordert, da die Dekarbonisierung nicht funktioniere.
Es liegt nun an Deutschland, ob sich Takáč und andere Klimawandel-Ignoranten durchsetzen. Wenn es Umweltminister Carsten Schneider (SPD) mit dem Klimaschutz noch ernst meint, dann muss er den aktuellen CO2-Preis (55 Euro pro Tonne) nun angemessen hochziehen. Um einen Anreiz für CO2-freies Heizen und E-Mobilität abzusichern.
Und er muss dafür sorgen, dass Menschen mit kleinem Einkommen vom Staat stärker beim Umstieg auf Wärmepumpen und Strom-Autos unterstützt werden. Mit beiden Maßnahmen lässt sich nachweisen, dass Dekarbonisierung doch geht.
Sports
Mafia soll die Finger im Spiel gehabt haben: Deutscher Klub um Europapokal betrogen?
Sports
NRW-Gesetz gegen Diskriminierung durch staatliche Stellen
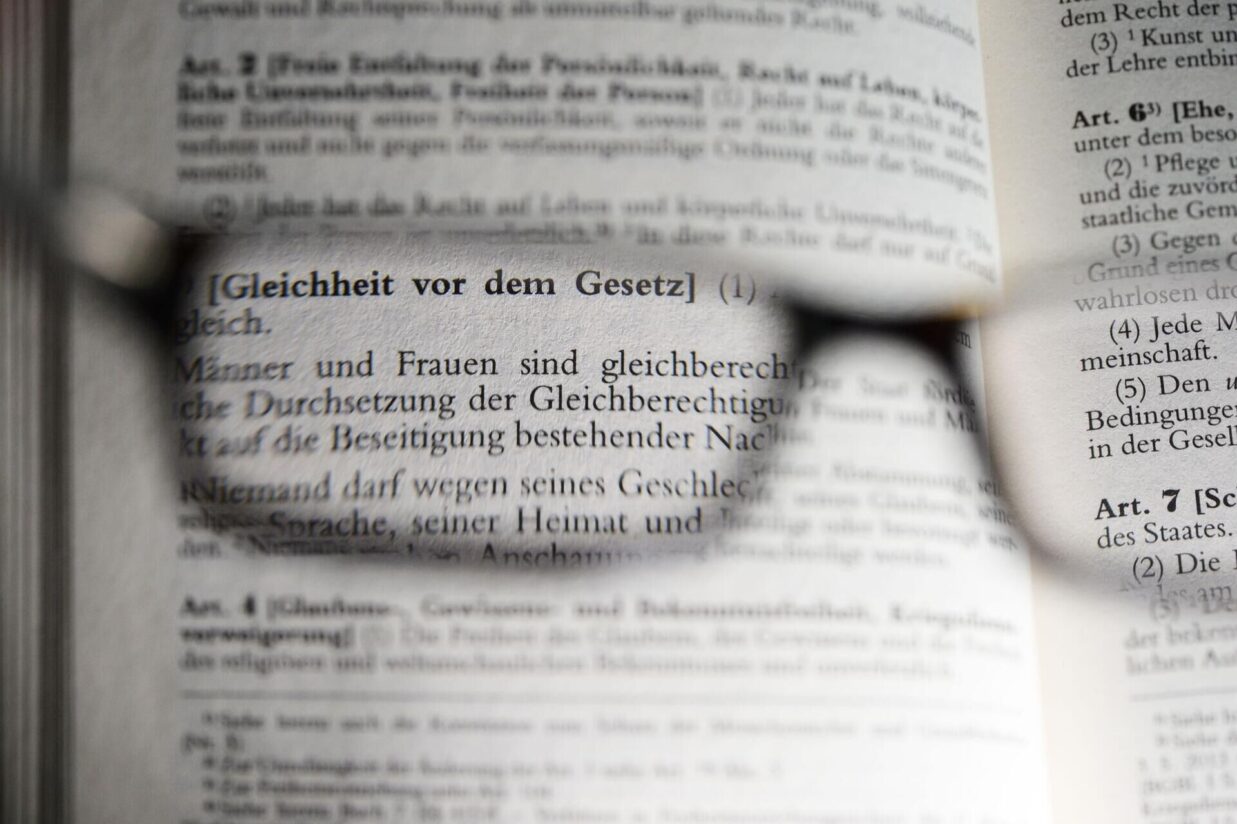
Lesezeit
Verfasst von:
dpa
Ein Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) soll die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen stärken. Der Entwurf enthalte einen Katalog von Diskriminierungsmerkmalen, erläuterte NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Demnach soll es allen Landesstellen verboten sein, jemanden etwa aufgrund von antisemitischen oder rassistischen Zuschreibungen, Nationalität, Herkunft, Religion, Geschlecht, Sexualität oder Alter zu diskriminieren.
Der Entwurf wird nun zunächst von Verbänden beraten. Das im schwarz-grünen Koalitionsvertrag angekündigte Gesetz soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Kraft treten.
NRW will vorangehen
Für kommunale Behörden wird es nicht gelten. „Das Land geht in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich voran“, erläuterte Paul. Als Beispiele nannte sie etwa Schulen, Hochschulen und Finanzämter. NRW sei das erste Flächenland, das eine solche Novelle einführe. Bislang existiere ein LADG nur im Stadtstaat Berlin.
Mit dem Gesetz solle eine Schutzlücke, die bisher bei Diskriminierung durch öffentliche Stellen bestehe, geschlossen werden, sagte Paul. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz umfasse nur den privatrechtlichen Bereich, unter anderem Fragen des Wohnungsmarktes oder des Arbeitsplatzes in der Privatwirtschaft.
Ein Misstrauensvotum gegen staatliche Stellen sei das nicht, versicherte die Ministerin. Es liege aber auf der Hand, dass es angesichts zunehmender Diskriminierungserfahrungen bundes- wie landesweit weiteren Handlungsbedarf gebe.
Wenn Mädchen im Mathe-Unterricht schlechter benotet werden
Das Gesetzesvorhaben soll Personen stärken, die etwa bei Anträgen oder einer Bewerbung in einer staatlichen Stelle aufgrund persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Als weiteres praktisches Beispiel nannte die Ministerin, wenn im Mathematik-Unterricht Mädchen systematisch benachteiligt und schlechter benotet würden.
Aber: „Es reicht nicht, einfach ein diskriminierendes Verhalten zu behaupten“, betonte Paul. Wer bei der entsprechenden staatlichen Stelle eine Diskriminierung beklage, benötige Indizien, die nahelegten, dass es sich tatsächlich um eine Benachteiligung handle. Zwar sei eine erleichterte Beweisführung geplant, allerdings keine Beweislastumkehr. Die betroffenen Beschwerdeführer könnten unterstützt werden durch die 42 Beratungsstellen der Freien Wohlfahrt für Antidiskriminierung in NRW.
Der Gesetzentwurf normiere deutlich, dass Abhilfe vor eventuellen Schadensersatzansprüchen stehe, erklärte Paul. „Erst wenn klar ist, dass diese Abhilfe so nicht möglich oder nicht mehr zumutbar ist, entsteht auch ein möglicher Anspruch auf Schadenersatz.“ Der wiederum richte sich stets gegen das Land, nicht gegen einzelne Behördenmitarbeiter. Die sollen durch Fortbildungen entsprechend sensibilisiert werden.
-

 Business9 months ago
Business9 months agoLegal Initiatives Intensify Around Abortion Pill Access
-

 Tech9 months ago
Tech9 months agoAllergie- & Immunologietage | Düsseldorf Congress
-

 Fashion7 months ago
Fashion7 months ago30 Tage Bikini Workout | Women’s Best Blog
-

 Fashion7 months ago
Fashion7 months ago8 Übungen gegen Cellulite | Women’s Best Blog
-

 Fashion7 months ago
Fashion7 months agoCellulite loswerden? Das hilft! | Women’s Best Blog
-

 Entertainment6 months ago
Entertainment6 months agoBRUIT≤ – The Age of Ephemerality
-
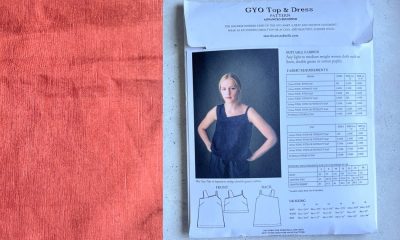
 Fashion4 months ago
Fashion4 months agoMe Made Mittwoch mit neuen Regeln am 02. Juli 2025
-

 Fashion9 months ago
Fashion9 months agoIn diesem Blogartikel findest du eine hilfreiche ➤ CHECKLISTE mit ✔ 5 TIPPS, um deine ✔ Zeit besser einzuteilen & deine ✔ Fitness-Ziele zu erreichen! ➤ Jetzt lesen!